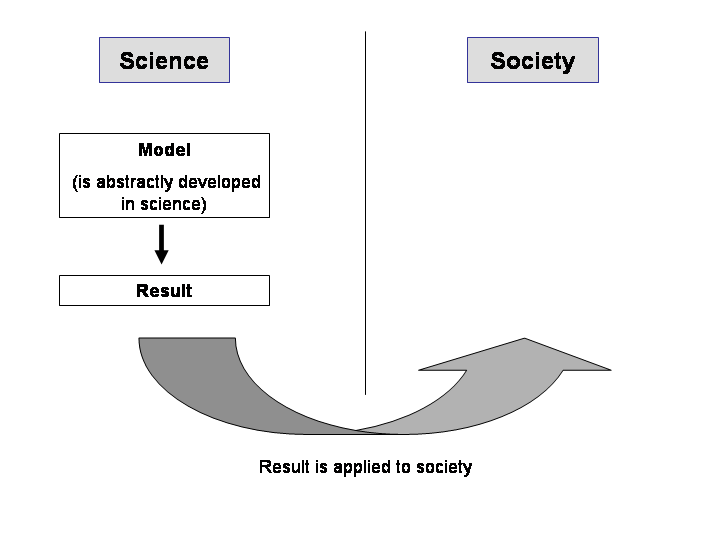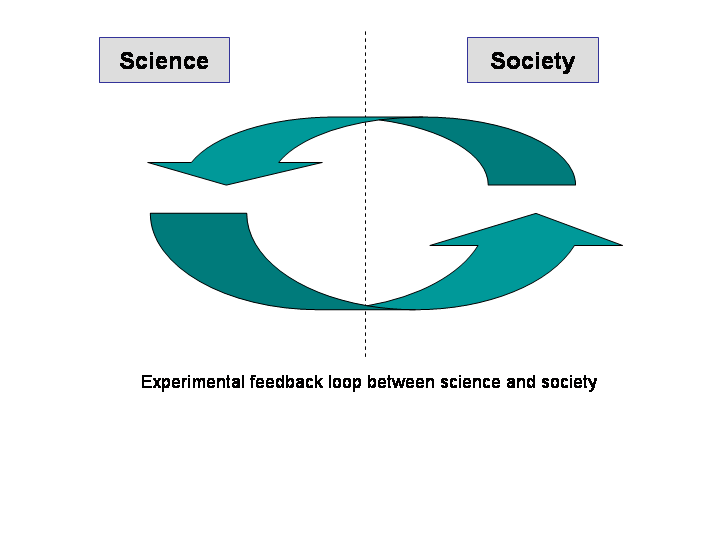Die Demonstrationen gegen den WKR-Ball (nun zynisch „Akademikerball“) sind inzwischen zu einem Fixpunkt nicht nur in der linken und antifaschistischen Szene geworden, sondern haben endgültig auch die Öffentlichkeit erreicht. Zahlreiche große Zeitungen nahmen den Ball und die Demonstrationen gegen ihn ihre Headlines auf und widmeten ihm mehrere Seiten und auch das mediale Echo im Ausland zeugt vom gewachsenen „öffentlichen Interesse“. Viele mögen dies grundsätzlich als gutes Zeichen betrachten. Es werden allerdings im Zuge dieses „Öffentlich-Werdens“ zahlreiche Ambivalenzen deutlich, die letztlich nicht nur von kritischem Interesse sind, sondern wohl auch für die Akteur_innen kommender Protest-Events (zunehmende) Bedeutung haben werden.
Die zentrale Frage ist – was wird hier wie öffentlich ausgetragen, wer profitiert davon und auf welche Weise wirkt der diskursiv ausgetragene Konflikt auf die Organisation von Demo (und Ball) zurück. Denn naheliegend ist, dass sich zumindest die Strategien der Gegner_innen des rechten Balls auch an diese Begebenheiten anpassen werden müssen.
Deutlich wird mit der stärkeren Präsenz in den Medien ein gewisser logischer, quasi Sachzwängen folgender Argumentationszusammenhang, der in den Medien selbst nie beleuchtet wird, allerdings auch in den Positionierungen zum „medialen Gefecht“ (etwa im Web 2.0 und Forumsbeiträgen) selten durchschaut wird. Schlagwortartig ließe sich dies anhand folgender medialer Anker festmachen: „Antifaschismus“, „Gewalt“, „öffentliches Interesse“, „politische Positionierung“.
Eigentlich sollte angenommen werden, dass es bei den Protesten primär um Antifaschismus geht. Nicht zuletzt die aktive Beteiligung von Holocaust-Überlenden bei den diesjährigen Protesten hätte gerade diesen thematischen Schwerpunkt in den Vordergrund rücken sollen. Es gibt allerdings in Österreich keine namhafte, langjährig öffentlich verankerte und differenziert geführte antifaschistische Tradition. Anders als in Deutschland, wo hier zumindest auf rudimentäre Grundsätze gebaut werden kann, wurde in Österreich als „erstem Opfer“ des NS der Antifaschismus als lästige Pflicht empfunden, die mehr oder minder doch erfüllt werden muss. Selbst im ehemals „sozialistischen“ Lager ist das weitestgehend der Fall (gewesen), auch wenn hier zumindest ein politischer Minimalkonsens besteht (der sicherlich von zahlreichen „Pragmatiker_innen“ verdammt wird), dass mit gewissen rechten Kräften keine politischen Allianzen eingegangen werden. Wie reduziert der Antifaschismus der SPÖ ist, wird unmittelbar deutlich, wenn die weitgehend ausbleibende klare Positionierung zum WKR-Ball ins Auge gefasst wird, die zwischen den Extrempolen eines abscheulich-neutralen staatsmännischen Zuggeständnisses an die „demokratische Rechtmäßigkeit“ des Balls durch den SPÖ-Bundeskanzler und den doch deutlichen Protesten der Parteijugend oszilliert. Der bürgerliche Mainstream des Landes hat aber über Lippenbekenntnisse und Bezüge auf „längst Überholtes“ hinaus bereits kaum etwas mit Antifaschismus am Hut. Antifaschismus ist nichts, das mit heutigen gesellschaftlichen Strukturen in Verbindung betrachtet wird, sondern bestenfalls Teil einer laufen “Erinnerungskultur”. Es verwundert also letztlich nicht, dass dieses Thema in der öffentlichen Debatte schnell in den Hintergrund rückte und nie wirklich differenziert verhandelt wurde: Keine Analyse was Antifaschismus heute und im Kontext eines rechten Events bedeuten kann oder soll, keine umfassende historische Kontextualisierung rechter Kontinuitäten und keinerlei positive Bezugnahme auf antifaschistische Organisationsformen. Dies festzustellen sollte alleine Grund genug für Ekel und Wut sein. Es erklärt allerdings gerade nicht, wie und warum der Event trotzdem so stark in den Medien bzw. der öffentlichen Debatte präsent sein konnte.
Es waren – leider und wie so oft – nicht die wirklichen Inhalte oder auf Basis differenzierter Analysen geführte Debatten, die das mediale Aufsehen erregten, sondern eine Mischung aus parteipolitischem Antagonismus (bzw. der dazugehörigen Rhetorik) und medialer Autoreferenz. Das Thema „Gewalt“ war hierfür der zentrale Katalysator. Bereits vor den Protesten, noch mehr jedoch nach ihnen ging es primär um die Einschätzung der politisch-diskursiven Effekte. Was macht dieses „Event“ mit der FPÖ, den Grünen, wem „nützt es“, wer kann sich profilieren – hier hatte durchwegs die FPÖ die Nase vorne, obwohl es scheinbar ursprünglich eine breite Sympathie für einen gewissen Kern der Anliegen der Ball-Gegner_innen gabt. Problematisch ist m.E. bereits, dass die Debatte sich nur noch um diese Fragen gedreht hat.
Bleiben wir allerdings kurz bei diesem „hegemonialen Kräftespiel“, so ist festzustellen, dass die Ergebnisse zumindest tendenziell schon vorgegeben waren bzw. durch die Rahmenbedingungen des politischen Klimas, in dem sie stattfanden, abgesteckt wurden. Gewissermaßen hatte hier die FPÖ von vorneherein die besseren Karten, da die politische Defensive auf Basis dieses Klimas mehr und letztlich stärkere diskursive Optionen bot, als es beim Angrifft durch „die Linken“ der Fall war – zumindest insofern letztere kaum Versuche starteten, den vorgegebenen Rahmen zu transzendieren. Diese Konstellation ist einerseits in einer allgemeinen (oft ins reaktionäre tendierenden) „Priorisierung politischen Passivität“ zu begründen: Generell wird progressiven und transformativen Kräften die Bringschuld untergeschoben, nicht jenen, die Altes verteidigen wollen. Die FPÖ schafft es in diesem konservativen Klima sehr gut, die Rolle der illegitim Angegriffenen zu übernehmen und sich als gemäßigte Bewahrerin eines hohlen „demokratischen Konsenses“ zu gerieren. Obwohl ihr das viele nicht abnehmen, scheint es doch kein ernsthaften politischen Gegenmittel zu geben. Ich denke dies hat mit einer Mischung aus Schockstarre und Unbeholfenheit hinsichtlich der eigenen Inhalte zu tun, allerdings auch, mit einem problematischen “Konsens”, den sich linke Kräfte all zu einfach aufdrängen lassen. Denn paradoxerweise war sprangen so gut wie alle relevanten linken Akteur_innen auf diesen Dampfer auf, auch das Empfinden derjenigen, die gegen die Rechten ankämpften bzw. eigentlich grundlegend Sympathie mit Protesten gegen den Ball hatten, scheint irgendwie zumindest argumentativ auf die Position der FPÖ festgefahren zu sein. Die Reaktion bei fast allen der im öffentlichen Diskurs etablierten Linken war konsequenterweise nicht mehr eine proaktive, sondern eine reaktive bis selbstkritische. Damit – und nicht mit wirklichen „Inhalten“ des öffentlich verhandelten Antagonismus – ist allerdings der Kampf bereits verloren. Denn es geht in der diskursiven Auseinandersetzung in keiner Weise um die Inhalte, sondern rein um Macht und Strategie. Analogien zu militärischen Kämpfen, wie sie etwa Antonio Gramsci machte, sind in diesem Hegemonialkampf also durchaus probat. Die Frage ist gerade in unseren „postdemokratischen Zeiten“ in der Regel nicht: wer hat Argumente, wer kann wirklich Substantielles vorweisen, bezieht sich auf “wirkliche Verhältnisse”. Die Frage ist vielmehr: wer schafft den diskursiven Ausbruch aus dem eingefahrenen öffentlich ausgetragenen Stellungskrieg und bekommt so die Oberhand in der öffentlichen, medial vermittelten, Debatte. Denn dieser punktuelle „Gewinn“ ist es letztlich, der als einziges „hängen bleibt“. Es geht tatsächlich gar nicht um die wirkliche Sache selbst – was gerade dann, wenn jene das Erbe des NS ist, sicherlich viele nicht kalt lassen wird. Trotzdem: so absurd diese Logik erscheinen mag, gibt es kein völliges Herumkommen um sie – auch nicht für linke Akteur_innen, die dies bedauern mögen bzw. eine Dimension abseits jenes repräsentativ-politischen Kalküls für wichtig erachten.
Dennoch sollten progressive Kräfte sich nicht einfach auf diese Dimension des (diskursiven) Machtkampfes ohne Inhalt beschränken lassen, ja ihn zumindest nur widerwillig bzw. mit Verachtung betreiben. Denn nicht nur ist sonst der Weg zum Faymann oder zur Glawischnig schon geebnet, auch werden die Chancen und Grenzen jenes Hegemonie-Kampfes (oft) falsch eingeschätzt. Wie gesagt ist diesbezüglich das passiv-reaktionäre Klima, das auch der Position der Mehrheitsgesellschaft entspricht, ein primäres Problem. Es gibt hier einfach vielmehr Einschränkungen für die eine, als die andere Seite – auch und gerade wenn sich Linke als “die Guten” und “Progressiven” fühlen können. Zwar lassen sich die Grenzen des hegemonialen Feldes verschieben, aber dies dauert lange und hat mehr oder minder stets auch die „formgebundene“ Grenze, welche durch die breiteren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vorgegeben wird. Gemäß diesen ist der politische Impetus tendenziell immer eher einer der Reproduktion und Stabilisierung der Verhältnisse. Es ist natürlich nötig, hier trotzdem weiter die Mühen der Ebene zu beackern. Ausbrüche aus diesem Teufelskreis sind aber partiell durchaus möglich, wofür jedoch auch innovative und anderweitige linke Handlungspotentiale in Betracht gezogen werden müssen. Im vorliegenden Fall würde ich behaupten, dass gerade das Thema „Gewalt“ hierfür von zentraler Relevanz ist.
Wie wurde auf den Vorwurf der Gewalt von der (in der Öffentlichkeit präsenten) Linken reagiert? Und was war die mediale Funktion des Gewaltdiskurses? Die Reaktion von Seiten fast aller (linker) Sympathisant_innen war eine umfassend defensive. Der „schwarze Block“ wurde für seine „Gewalt“ verdammt, zumindest aber wurde der diskursive Vorteil, der aus dem Gewaltdiskurs für die Rechte erwuchs, als das zentrale Problem moniert, dem eins auch nichts entgegenzusetzen weiß. Zwei Dinge sind an diesem Vorgehen falsch.
Einerseits kann grundlegend eingewandt werden, dass die reaktionäre Invektive der Gewaltanschuldigung politisch in keiner Weise gekontert wurde. Es wurde schlicht die vorherrschende Definition von „Schwarzer Block=Gewalt=schlecht“ übernommen, ohne hier eine differenzierte Perspektive auch nur anzudenken. Denn eigentlich ist es ja hoch problematisch, wie das Thema Gewalt verhandelt wird. Im Zuge der Demonstration kam es primär zu Sachbeschädigungen. Dass die unmittelbare physische Gewalt durchwegs nicht (ursächlich) von den Demonstrant_innen ausging, sondern in einem eskalativen Zirkel maßgeblich von der Polizei verursacht wurde, ist ja sogar in der Debatte zu hören. Die gerade in Österreich bitter notwendige Kritik der Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols in Form von überzogener physischer und psychischer Gewaltausübung durch (selbst meist ins autoritäre oder auch politisch rechte tendierenden) Polizist_innen wird damit bereits sehr früh abgebrochen. Hier lässt der reaktionäre, obrigkeitshörige Konsensus auch bei den Linken grüßen. Noch mehr sollte allerdings hinsichtlich der Sachbeschädigungen, die eigentlich einen Großteil der öffentlichen Empörung über und medialen Resonanz des Gewaltdiskurses ausmacht, eine nicht bloß defensive Position eingenommen werden. Über die Sinnhaftigkeit solcher lässt sich streiten. Aber dass die Zerstörung von Dingen (noch dazu solcher, die kaum unmittelbar einem persönlichen Lebenszusammenhang entspringen) unisono mit der Gewalt gegen Menschen vermengt wird, ja eigentlich die „Gewalt gegen Dinge“ – ein kategoriales Unding – in den Anschuldigungen diskursiv überhandnimmt, sollte mehr als nur befremden. Eigentlich sollte aktiv gegen diese problematische Vermengung selbst vorgegangen werden, das rechte Totschlagargument sollte nicht (selbstkritisch) angenommen, sondern inhaltlich lautstark bestritten werden. Zerstörung von Dingen ist etwas ganz anderes als Gewalt gegen Menschen und die Vermengung beider bietet bereits Potential für eine Kritik jener gesellschaftlichen Ordnung, die Dinge sooft höher bewertet, als Menschen. Eine Ordnung, in der über psychische Gewalt, wie sie etwa in der sozialen Binnenstruktur “Familie” oft vorkommt und strukturelle Gewalt – wie etwa jene des Staates, gegen Menschen ohne Staatsbürger_innenschaft – viel zu wenig explizit gesprochen wird. Dafür aber der Angriff auf Sachgüter als höchster Affront und Störung der “Ordnung” gilt. Der viel beschworene „Schwarze Block“ unterscheidet sich gerade hier zumindest en gros von rechten gewalttätigen Gruppen – er zielt nicht auf menschliches Leben, richtet seine Zerstörungswut nicht gegen sozial wenig privilegierte und/oder als „Andere“ markierte Menschen, sondern richtet sich – zumindest der Intention nach – gegen jene Ordnung, welche die Dinge über die Menschen stellt. Erneut lässt sich natürlich über die Sinnhaftigkeit einzelner Aktionen streiten – für eine generelle Entsolidarisierung, die auf den falschen Gewaltdefinitionsdiskurs affirmativ aufspringt, reicht dies allerdings nicht. Auch wäre jene diskursiv nicht nötig, würde bewusst die Initiative ergriffen und ein Ausweg aus den rechten und konservativen Totschlagargumenten gesucht – dass derartige „kreative“ und proaktive Auswege aus solchen Situationen funktionieren können, beweist nicht zuletzt gerade die politische Rechte immer wieder grandios. Dem spalterischen Ansinnen der Rechten müsste jedenfalls nicht vorauseilend nachgekommen werden.
Es gibt allerdings auch noch eine andere Seite, hinsichtlich derer der Gewaltdiskurs problematisch ist. Denn erneut geht es in ihm eigentlich nicht wirklich um die „Inhalte“, ist die Empörung über die Gewalt scheinheilig bzw. entspricht mehr einer ritualhaften Anbiederung an einen öffentlichen Ordnungsdiskurs, der nicht wirklich substantiell ist. Die tatsächlichen Sachbeschädigungen sind verhältnismäßig gering und werden wohl – gerade angesichts derer, die hiervon betroffen sind – weitgehend von Versicherungen getragen werden. Was vielmehr zählt ist der skandalöse und medial aufgebauschte Effekt, den ein gewisses gewaltförmiges Auftreten bereits erzielt, noch mehr natürlich die stellenweise Konfrontation. Hier sind wir auf der Ebene des (medialen) Spektakels, das sich weitgehend auch selbst reproduziert. In diesem Spektakel haben alle ihre Rolle, können teils auch nicht anders. Am Deutlichsten wir dies bei den Medien selbst: scheinheilig haben sie gegen die „Zensur“ opponiert, berichten nun aber durchgehend negativ über die „Gewalt“. Dabei ist es aber gerade diese „Gewalt“ – bzw. eigentlich der selbstreferentielle und spektakuläre Diskurs über sie – der sie letztlich besonders anzieht. Überspitzt könnte gesagt werden, dass der Protest gegen die Zensur maßgeblich den Zweck hatte, vor Ort sein zu können, um Bilder der suggerierten Gewalt machen zu können. Umgekehrt macht wiederum diese „Gewalt“ selbst maßgeblich das „öffentliche Interesse“ der Veranstaltung aus, auf dessen Basis die Einschränkungen überhaupt erst moniert wurden. Aber auch Demonstrant_innen reproduzieren das Ganze natürlich teilweise mit, da eine martialische Inszenierung – selbst wenn sie teils nur aus Selbstschutz vor Polzeigewalt angenommen wird – diese Bilder befeuert. Die Polizei schließlich kann sich als Vertreter der „Ordnung“ und des Gewaltmonopols, als einzig berechtige Gewaltausübende inszenieren (was gerade als Ausdruck der ultimativen Macht dem autoritären Charakter gewisser Menschen besondere Genugtuung verschafft). Einer weitere Versicherheitlichung der sozialen und politischen Verhältnisse wird damit zugearbeitet. Letztlich spielen hier also alle ihre Rollen und die Spielräume scheinen gering. Wie aus der Immanenz des politischen Antagonismus, so ist auch ein Auskommen aus dem Zirkel des medialen Spektakels tatsächlich schwer möglich. Es gibt sicherlich keinen Königsweg. Bewusst sollten sich linke Akteur_innen aber sein, wie der medial inszenierte „öffentliche Diskus“ funktioniert. Denn durchwegs scheint es so, als ob dieses Bewusstsein bei der anderen Seite klarer vorhanden ist.
Wichtig wird es schlussendlich sein, ob und wie emanzipatorische Kräfte sich abseits von medialem Spektakel und politischen Hegemoniekämpfen formieren. Wie also diese Logiken umfassend durchschaut werden können, um sie zumindest im eigenen Lager nicht mehr zu kultivieren. Darüber hinaus bleibt es trotzdem bzw. gerade auf Basis dieser Orientierung wichtig, Strategien des Bezugs auf diese eigentlich abzulehnenden Orientierungen zu entwickeln. Denn so sehr eine „anti-politische“ und „anti-spektakuläre“ Orientierung für linke Bewegungen – gerade in Zeiten einer umfassenden öffentlichen Krise – der wohl zukunftsträchtigste Weg ist, darf die notwendig immer schon vorgefundene Einbindung in immanente Auseinandersetzungen nicht ignoriert werden. Dies gilt insbesondere für antifaschistische Bestrebungen, die nicht immer nur auf der Straße oder in unmittelbaren sozialen Kontexten situiert sind, sondern letztlich auch in der Öffentlichkeit geführt werden müssen. Denn dort ist die Rechte und Rechtsextreme gerade in Österreich viel zu stark verankert, legitimiert und präsent.